17. Jahrhundert. Wenn wir als Beleg für die durch die Unzahl der Ladungstempos herbeigefühlte Langsamkeit des Feuers so häufig angeführt finden: «es habe in der Schlacht bei Nördlingen (1634) der langsamste Musketier sechsmal gefeuert», so war dies eben ein sehr langsamer. Dagegen erzählt Valkenier (Verwirrtes Europa, Amsterdam 1677), «bei der Belagerung der Schanze Knodsenburg im Jahre 1672 hätte jeder Musketier der Besatzung in einer Nacht ungefähr 120 Schüsse gemacht». In Valkeniers wichtigem Geschichtswerk wird auch wiederholt angeführt, was übrigens in mehreren gleichzeitigen Schriften erwähnt ist, dass von den an die Brust gestemmten Kolben der Musketen, die Brust oft braun und blau geworden, ja aufgeschwollen und bei einigen der kalte Brand dazu geschlagen sei. Braun und blau, ja blutig geschlagene Backen und Nasen haben wir übrigens noch,1 besonders im ersten Vierteljahr des 19. Jahrhunderts, beim Scheibenschießen mit österreichischen Musketen,2 Karabinern und sogar mit den glatten Jägergewehren durch unzweckmäßige Schäftung, Missverhältnis des Gewehrgewichtes zum Kaliber und mangelhafte Haltung des Gewehres oft herbeigeführt gesehen, daher wurden auch oft im Festungsdienst Kissen mit Schnüren zum Anhängen (coussinets a musquetaire) an die Truppen verteilt.
Um 1670. Die Stinktöpfe, welche bei Belagerungen des 17. Jahrhunderts besonders im Minenkriege eine bedeutende Rolle spielten, taufte der Witz der protestantischen Niederländer mit dem Namen «Jesuitenmützen».
Um 1500. Wir besitzen in älteren und neueren Städten und Festungen verschiedenartige Schilderhäuser, breterne, gemauerte, steinerne. Die seltsamste Gattung, vielleicht ein Unikum dürften jene in der herrlichen Burg Hunyad in Siebenbürgen gewesen sein, wo an der Außenseite der sogenannten «Munitionsbastei» zu Zeiten der Gefahr acht an starke eiserne Nägel gehängte Körbe die Stelle von ebenso vielen Wächterhäuschen vertraten.
1630. Im Erbschaftsinventar eines Amberger Försters vom Jahre 1630 kommen «Katzenspieß und schafft» vor. Eine Kriegswaffe waren diese Spieße nicht, da sie in keinem Zeughausbuch oder ähnlicher Quelle erscheinen. Ihre spezielle Jagdbestimmung aber ersehen wir aus einer Darstellung in des Freiherrn von Hoberg «Georgica curiosa», Nürnberg 1701, wo im II. Bande S. 745 eine Jagd auf Wildkatzen abgebildet ist, wobei mit pikenähnlichen langen, dünnen Spießen diese Tiere von den Bäumen herabgestoßen werden.
1 Der Leser wolle sich immer erinnern, dass das hier veröffentlichte Manuskript in den letzten Jahren des vierten Dezenniums geschrieben wurde.
2 Soll hier korrekter «Flinten» heißen, unter Muskete versteht man in der Regel ein Radschlossgewehr.

Unter die seltensten Waffengattungen gehören die Dusaken (auch Dusäggen, Dusakel usw. geschrieben). Man hat den Ursprung dieses Namens irrig im Böhmischen gesucht; ich glaube, er ist entweder von dem altdeutschen «Tusic» (stumpf), oder von dem ebenfalls altdeutschen «twoseax» (sprich tusäx) herzuleiten, welches so viel als Doppelmesser bedeutet. Für die erstere Annahme spricht, dass die Dusake seltener als Kriegswaffe, hauptsächlich aber auf Fechtschulen gebraucht wurde. Solcher Gebrauch hat sich in Wien auf den Fechtböden der Handwerksgesellen, z. B. beim braunen Hirsch in der Rotenturmstraße, bis in das erste Viertel des 18. Jahrhunderts erhalten, und es ist erklärlich, dass diese schwere, der Hand gar keinen Schutz als jene der Geschicklichkeit bietende Waffe noch weniger scharf geschliffen sein durfte, als unsere jetzigen Haudegen. Unstreitig war die Dusake im Widerspruch mit der Zierlichkeit so vieler älterer Hiebwaffen die ungestaltetste, geschmackloseste und plumpste. Ein kurzes, ziemlich breites und dickes Eisenstück, schwach gekrümmt, am unteren Ende verjüngt zulaufend, aber ohne eigentliche Spitze, hatte sie auch keinen eigentlichen Griff, sondern nur am oberen Ende ein Loch in der Klinge, um die Finger mit Ausnahme des Daumens durchzustecken. Dabei waren einzelne Exemplare von übermäßiger Schwere.
1650—1730. Es ist kaum glaublich, wie langsam der Fortschritt bei einzelnen militärischen Erfindungen war, so z. B. bei dem Bajonett. Wie lange brauchte es, bis man dazu kam, mit aufgepflanztem Bajonett zu feuern? Dass man dies schon sehr früh versuchte, beweisen einzelne vorkommende Bajonette mit Holzgriffen, an denen eine Feder angebracht ist, um sie neben dem Lauf einstecken zu können. Dann versah man die Bajonette zwar statt des Holzgriffes mit einer Dille, diese aber mit gar keiner Vorrichtung, um das Drehen der Klinge um den Lauf zu verhindern oder diese festzustellen. So musste wohl beinahe bei jedem Schuss das Bajonett wegfliegen und sogar zum Gebrauch als Stoßwaffe sich schlecht bewähren. Selbst um 1750 noch waren die durch Einschnitte in den Dillen an den Laut befestigten französischen Bajonett so zweckwidrig eingerichtet, dass ihr Hals und daher auch die Klinge, statt seitwärts vom Lauf, gerade über demselben stand, daher jedes nur einigermaßen genaue Zielen unmöglich wurde. Übrigens waren ohnehin alle Feuergewehre der Franzosen jener Zeit, von der Wallflinte bis zur Pistole, ja sogar die gezogenen Gewehre der Karabiniere ohne Absehen und Korn.
Vor dem Jahre 1560 schon findet man einläufige gezogene Gewehre mit zwei Radschlössern und zwei Zündlöchern, um zwei Schüsse aus einem Lauf machen zu können, ohne wieder frisch zu laden, dabei diente der untere besonders fest geladene Schuss gleichsam als Stoßboden für den oberen. Bloß der Sicherheit der Entzündung wegen hatte man auch Gewehre mit zwei vereinten Radschlössern, eigentlich mit zwei Hähnen und einem Rad, ziemlich häufig. Bei diesen liegen beide Hähne mit ihren Steinen auf dem einen Rad. Der Grund dieser Einrichtung lag in dem leichten Stumpfwerden der Schwefelkiese, welches bei zweien1 doch nicht so schnell eintrat, als bei einem. Daher hatten die Franzosen auch die angeblich von Vauban erfundenen, aus Lunten- und Flintenschloss zusammengesetzten fusil-mousquet-Schlösser sowie man früher schon an alten Feuergewehren Rad- und Luntenschloss nebeneinander angebracht findet.
So früh man, wenigstens teilweise, das gezogene Rohr zum Kriegsgebrauch anwendete, so scheint sich gegen dasselbe das Vorurteil, als sei es eine unheimliche, unehrenhafte, meuchlerische Waffe, noch sehr lange erhalten zu haben. Selbst auf bürgerlichen Schießstätten ließ man sie nicht überall zu. So z. B. wurden in der Stralsunder Schützenordnung vom 8. Mai 1640 «die gezogenen und geriffelten oder gegrabenen Rohre» unter die «ungewöhnliche Rüstung» gerechnet und ihr Gebrauch verboten. Dagegen in der Stralsunder Verordnung für das Vogelschießen vom 30. Juni 1681 erlaubt. Nach Lavater (Kriegsbüchlein von 1651), der freilich gerade in Beziehung auf kriegsgebrauch widrige Waffen und ähnliche Dinge bisweilen in arge Widersprüche gerät, sollen sogar jene, die gezogene Rohre führen, «das Quartier verwirkt» haben, d. h. nicht als Gefangene genommen, sondern getötet werden. Diese traurige Folge dehnt er auch auf die französischen «Füsen» (fusils, Steinschlossgewehre, Flinten) und die «geflammten Degen» aus.
Um 1630. Fausthämmer oder kleine Streitäxte waren, wie bekannt, eine Lieblingswaffe der Reiterei im Dreißigjährigen Krieg.2 Weniger bekannt mag es sein, dass einige dieser Waffen ganz aus Eisen (Stahl) waren und hohle, mit einer Schraube geschlossene Griffe hatten, in welchen Feile, Bohrer, Handsäge und ähnliche kleine Werkzeuge verborgen waren,3 ein gewiss sinnreicher Ort für Einbrecherwerkzeug!
1703. Die Schweinsfedern, welche die österreichische Infanterie für die spanischen Reiter selbst tragen musste, während die Balken nachgefahren wurden, erschienen den Truppen als eine so unbequeme Last, dass sie häufig weggeworfen wurden. Man gab daher schon im Jahr 1703 jedem k. k. Infanterie Regiment drei Schweinsfederkarren.4
Der «Grätzer Mercur» brachte im Jahre 1757 einen vom 30. März aus Wien datierten Artikel des Inhaltes: Weil sich in der Schlacht von Lobositz gezeigt, dass die preußische Reiterei eiserne Kreuze mit gutem Nutzen unter denen Hüten getragen, so hat die kaiserl.-königl. Reiterei nun gleicher Gestalt derlei Kreuze, und zwar mit biegsamen eisernen Federn, auch an denen Hüten Drahtriemen bekommen, womit sie die Hüte beim Anfang einer Schlacht unter den Bärten feste binden und zugleich die Backen für den Hieb besser schützen können, auch werden alle Pferdezügel mit Draht überzogen.» Wie ungenügend man übrigens noch im Jahre 1787 den Schutz der Hüte bei der Reiterei gegen die Säbelhiebe der Türken hielt und wie man ebenso auf andere Schutzwaffen dachte, deutet ein in den «Provinzialblättern der k.k. Staaten usw.» von 1787 abgedrucktes Schreiben aus Essegg vom 14. November an: «Die Cavalerie ist neuerlich mit Pickelhauben und mit Harnischen (sic!), die sowohl den Rücken als die Brust decken, versehen worden.»
1720. Dass mit den Czakány bisweilen auch im Krieg geworfen wurde (welchen Gebrauch die Ungarn vom Hirtenleben, wo manches Häschen auf diese Weise erbeutet wurde und noch heute erbeutet wird, in das Feld mitbrachten) ist bekannt. Ein gut gezielter kräftiger Wurf mit dieser scharf schneidenden, ziemlich schweren und überdies vorgewichtigen Waffe musste allerdings gefährlich sein,5 Aber selbst der Buzogany scheint zuweilen als Wurfwaffe benutzt worden zu sein. So wurde ein kaiserlicher Oberst Colloredo, 13. Oktober des Jahres 1720, zurzeit als Hamburg von den Bethlenschen Truppen berennt und dreizehn Mal vergeblich gestürmt wurde, bei Bruck an der Leitha von den ungarischen Malcontenten überfallen, geschlagen und mit einem «Pusikan in den Rücken getroffen». Ob übrigens nicht vielleicht in der Relation der Buzogany (Streitkolben) mit dem Czakány verwechselt wurde? _
Wo mag George Hiltl die in dem Aufsatz: «Aus dem Rechtsleben des Mittelalters» (Gartenlaube 1863 S. 618) mitgeteilte Nachricht herhaben: «Im siebenjährigen Kriege kamen bei den österreichischen Husaren Säbelklingen in Gebrauch, welche mit Quecksilberrinnen versehen waren.» Abgesehen davon, dass mir außer dieser unbelegten Notiz über solche Klingen nirgends eine andere aufstieß, wären dieselben bei der Schwierigkeit ihrer Erzeugung jedenfalls zu einer Kommisswaffe zu teuer, übrigens auch zu gebrechlich gewesen. Ich habe überhaupt, ungeachtet meiner Forschungen in zahlreichen öffentlichen und Privatwaffensammlungen, nur zwei solche Klingen gesehen. Die eine, französisches Erzeugnis des 18. Jahrhunderts, war eine wenig gekrümmte ziemlich lange Säbelklinge, die andere gehörte einem Scharfrichterschwert des 17. Jahrhunderts. An der ersteren war übrigens die Rinne durch einen Hieb gesprungen und das Quecksilber ausgeronnen. Das gerade kurze Scharfrichterschwert hatte die Rinne am Rücken der einschneidigen Klinge in gutem Stand, nur das Quecksilber, welches bei einem Hieb des mit der Spitze etwas aufwärts gehaltenen Schwertes mit großer Gewalt gegen diese Spitze vorschoss, gab dem Hieb eine bedeutende Kraft.
In alten Schlössern werden sehr häufig Kanonen aufbewahrt, die nicht nur wegen der Kleinheit ihres Kalibers, sondern besonders wegen ihrer Kürze und wegen der Niedrigkeit ihrer Lafetten einer bloßen Spielerei gleichen. Letztere erschwert ihren Gebrauch ungemein und sie dürften vorzugsweise nur zu Salven bei Festlichkeiten gedient haben. In den österreichischen, steirischen und krainerischen Schlössern mögen sie aber gegen die Tataren und andere leichte Truppen der Türken, bei deren ehrfurchtsvoller Scheu vor dem Geschütz und was demselben einigermaßen gleichsah, doch als Schreckmittel wirklichen Nutzen gebracht haben.
Dass es zu den ehrenvollsten Kapitulationsbedingnissen bei der Einnahme von Festungen gehörte, wenn die Garnison mit brennenden Lunten ausziehen durfte, ist bekannt, und ebenso, dass sich diese Begünstigung nicht auf die zu dem Geschütz gehörigen Lunten beschränkte, sondern auch auf jene an den Schlössern des Kleingewehres erstreckte. Als eine Gradation dieser Auszeichnung dürfte erscheinen, die in verschiedenen älteren Werken, namentlich in Lesdiguiéres Lebensbeschreibung vorkommt, wo es heißt, dass die Garnison von Brigueras mit «meches brulantes par les deuxbouts» ausziehen durfte. Es ist aber dies nicht der Fall, da die Musketiere ihre Lunten im Fall der Gefechtsbereitschaft immer an beiden Enden angezündet trugen, weil nicht selten die Lunte durch das Pfannenfeuer, besonders bei großen Zündlöchern, ausgelöscht wurde.
1480. Man gebrauchte die Helmbarten und Spieße nach Umständen auch oft als Werkzeuge, erstere z. B. um Zugbrückenketten abzuschlagen usw., letztere als Zeltstangen für improvisierte Zelte und in einem einzigen Falle sogar zur Überbrückung. In Witwolt von Schaumburgs Leben (50. Publikation des literarischen Vereines in Stuttgart 1859) wird aus der Belagerung von Arras erzählt: «Der hauptmann lief mit etlichen knechten zur kleinen stat, da waren die tor noch zue. Sie machten ein gerüst mit langen spiessen von der pruck über den graben auf die mauer, hatten einen knecht von halben sinnen, den überredet der hauptmann, das er auf dem gemachten gerüst herüber rutscht, ob er die veind umb sich sehe oder vernehme usw.» Wahrscheinlich konnte sich nur ein Halbirrer entschließen, diese luftige Rekognoszierung auf einem so schwankenden Boden zu vollführen.6
1500. In der Schlacht von Henningstadt (Februar 1500), in welcher die Ditmarschen dem König Johann von Dänemark eine so furchtbare Niederlage beibrachten, bediente sich die große dänische Garde ihrer langen Spieße, um die vielen Gräben zu überbrücken, um in breiter Front angreifen zu können. Sie legten die Spieße quer über die Gräben und deckten sie mit Brettern und Hürden.7
Fouragiersensen, deren Klinge durch eine sehr einfache Vorrichtung gerade aufgerichtet und festgehalten werden konnte, um dann das Werkzeug als Waffe gebrauchen zu können, erfand um 1600 ein französischer Generalkapitän der Artilleriearbeiter. Sie sind in S. Remy’s «Memoires d’Artillerie» abgebildet, scheinen aber nicht in Gebrauch gekommen zu sein.
1 Bei wechselseitiger Benützung beider Hähne.
2 Nicht so sehr, im Gegenteil, seit Einführung der Faustrohre kamen sie in der Reiterei sehr in Abnahme; nur bei den ungarischen und polnischen Reitertruppen findet man sie noch allgemein in Verwendung. Unter den Kürassieren Maximilians I. war der «Kirissbengel» ein allgemeines Ausrüstungsstück und selbst deren Rottmeister führten Fausthämmer mit langen Stacheln als Würdenzeichen. Mit der Abnahme der Harnische verloren die Schlagwaffen, die ja vorwiegend dazu dienten, die Harnische zu zertrümmern, ihren Zweck.
3 Für diesen Gebrauch haben wir ein mehr als 200 Jahre älteres Beispiel. In zwei reich verzierten gotischen Streitkolben aus Bronze aus dem Besitz des Kaisers Friedrich III. in der kaiserl. Waffensammlung zu Wien von ca. 1460 finden sich in der Höhlung der verschließbaren Handhaben ein metallener Zollstab und ein zusammenlegbares Triktrakbrett.
4 Das war gewiss sehr wenig. Diese nachgeführten Schweinsleder konnten nur als Ersatz für weggeworfene oder sonst verlorene gedient haben.
5 Czakány ist ein Stock mit einem metallenen Handgriff von der Form einer kleinen Streithacke. Er ist ebenso wohl eine Waffe als eine Stütze beim Gehen und wird noch heute in Ungarn vom Edelmann wie vom Bauer getragen. In gleicher Art wird auch der Fokus dortselbst getragen, der in einem Stocke besteht, welcher als Handhabe einen kleinen metallenen Streithammer besitzt.
6 Die geringe Geschicklichkeit der Leute der damaligen Zeit vorausgesetzt und die Eile der Herstellung in Feindesnähe berücksichtigt; aber aus Langspießen lassen sich Stege errichten, welche selbst bei weit stärkerer Belastung durchaus nicht schwanken. Das Interessanteste für den Waffenhistoriker ist an dieser Notiz, dass 1480 schon Langspieße in Gebrauch waren, die ein derlei Gerüste zu fertigen gestattet hatten.
7 Bei einer so missbräuchlichen Verwendung der eigenen Waffe haben sie sich ihre Niederlage redlich verdient.

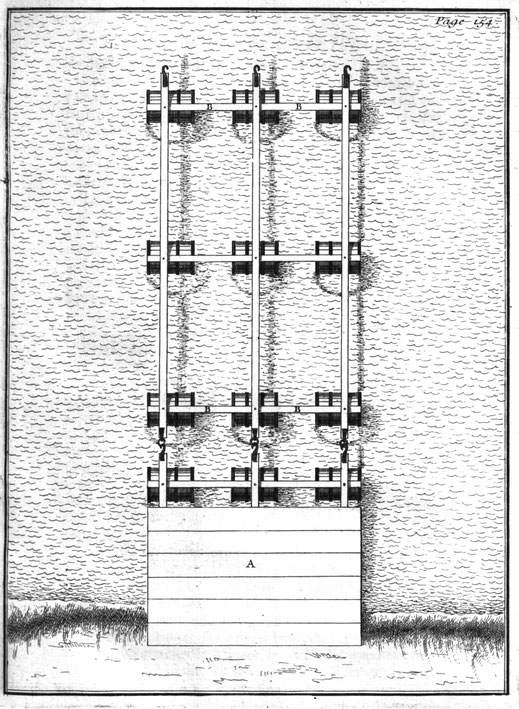
Unter den von den Franzosen aus dem Deutschen aufgenommenen und dabei gewöhnlich arg verstümmelten Benennungen (z. B. Arquebuse für Hakenbüchse, Havresac für Hafersack usw.) finden wir seit dem Ende des 16. Jahrhunderts auch den Waffennamen «Brin d’estoc». Wer erkennt unter demselben den in den Niederlanden und anderen von Kanälen und Gräben durchschnittenen Ländern so übliche, aber auch anderswo als wohlfeile und handliche Waffe gebräuchlichen «Springstock»?1 Es war dies eine bis 8 Fuß lange, an beiden Enden mit einfachen konischen Eisenspitzen versehene Stange, an deren einem Ende man meistens eine kleine Holzscheibe2 anbrachte, um das zu tiefe Eindringen der Spitze in die Erde zu verhindern, wenn der damit Bewaffnete sich zum Sprung anschickend mit dem ganzen Körpergewicht darauf wirkte.
In der Belagerung von Wien 1683 wurden sie besonders bei Ausfällen gebraucht. Der Degenstock gehörte (woran jetzt wohl wenig gedacht wird) früher ebenfalls unter die Kriegswaffen. Namentlich in französischen Zeughäusern war immer ein Vorrat von solchen aufbewahrt, sie hießen «Batons de Jaque» und besonders war in Frankreich jene Gattung behebt, bei welcher die im Stock mit der Spitze aufwärts verborgene Klinge nicht herausgezogen, sondern durch einen heftigen Schwung des Stockes herausgeschleudert, dann durch eine Feder festgehalten wurde, die Waffe sohin keinen Degen, sondern eine kurze Pike darstellte. Ihre Bestimmung war, den bei Überfällen als Bauern oder Kaufleute verkleideten Soldaten als heimliche Waffe zu dienen.
1574. Probeschüsse auf Brustharnische waren im 16. Jahrhundert besonders bei eigentlichen Feldharnischen bereits üblich und finden sich gewöhnlich auf der linken Brustseite.3 Bei Prachtharnischen findet man dieselben aber selten. Die an solchen ersichtlichen Kugeleindrücke rühren meistens vom Schlachtfeld her.
Merkwürdig und der gewöhnlichen Ehrenhaftigkeit der deutschen Handwerker jener Zeit sehr zuwiderlaufend erscheint es, dass einzelne Waffenschmiede mit einem Werkzeug Vertiefungen in Brustharnische schlugen und für Kugelproben ausgaben! Dies geht aus einem Schreiben des Bernhard Lerch, Hauptmannes der steierischen Landschaft, vom 19. April 1574 an den Herzog Johann Albrecht I. von Mecklenburg bei der Übersendung von zwei dem letzteren durch die steiermärkischen Stände zum Geschenk gemachten Harnische hervor, in welchem Lerch ausdrücklich bemerkt: «Die schuess, so in den peiden harnischen gefunden worden, sein nicht ausgeschlagen, sondern stehen noch aus dem ror angegangen sein.» (Grazer Tageblatt 1860, Nr. 266.)
Noch im bayerischen Erbfolgekrieg war es in einigen Heeren der Reiterei verboten, die Säbel zu schleifen, wahrscheinlich um dem Verderben der Klingen durch ungeschicktes Vorgehen vorzubeugen. Bei der bayerischen Reiterei soll aber im vorigen Jahrhundert das eigentliche «Dengeln» (Hämmern wie bei den Sensen), ungeachtet des bestehenden strengen Verbotes vorgekommen sein. Von Verwundungen mit gedengelten Klingen behauptete man, dass sie viel schwerer zu heilen seien.
1723 und 1797. Die erste Einführung von Hinterladegewehren für ein ganzes Korps fand im Jahre 1723 statt, wo das Dragonerregiment des Marschalls von Sachsen Karabiner mit dem von ihm erfundenen Hinterlademechanismus erhielt. Auch für die französischen Marinezeughäuser wurde eine bedeutende Menge ähnlicher Flinten angeschafft; bald aber verwarf man die ganze Einrichtung.
Später wurde beim Wiener Aufgebot im Jahre 1797 das Studentenkorps mit Hinterladekarabinern und langen ausspringenden Bajonetten bewaffnet. Da sich in den Klingen der letzteren ein halbmondförmiges, an den Rändern scharf geschliffenes Loch befand, welches furchtbare Verwundungen bewirkt haben würde, entstand die Besorgnis, es würde diese Waffe als völkerrechtswidrig betrachtet werden.4
1535. Dass in der Zeit, wo Eisenrüstung wenigstens teilweise beinahe von jedem Krieger getragen wurde, einzeln auch andere Stoffe zu Schutzwaffen verwendet wurden, beweisen die im Jahre 1535 mit Kaiser Karl V. freiwillig nach Afrika gezogenen deutschen Tuchmacher, welche weder Helm noch Harnisch, sondern Beinkleider, Wams und Mütze aus doppeltem Filz trugen und von dem Tuchmacher Ostermann 1527 erfunden worden war. (Mittheilungen des Geschichts- und Alterthumsvereines zu Leisnig, 7. Heft, S. 51, Leisnig 1868.) Mag übrigens im afrikanischen Klima eine etwas unbequeme warme Kleidung gewesen sein. Auch einzelne russische Korps hatten im Jahre 1813 Mäntel von einer Gattung dicken Filztuches, die sehr heiß und zum Tragen und Packen gleich unbequem waren.5
1580. Was ist ein Thardaeisen? Es kommt zum Preis von 24 Kreuzern in einer Rechnung des landschaftlichen Zeughauses in Graz vor und scheint von dem französischen dard (Wurfspieß, Wurfpfeil) abgeleitet zu sein,6 welche Waffe aber damals und selbst noch lange früher weder in Deutschland noch in Frankreich üblich gewesen war.
1673. In dem sehr interessanten Werk des Francesco Mazzioli «Precotti militari», Bologna 1673, sieht man die Pikeniere gegen die Reiterei Arm in Arm mit den Nebenmännern eingehängt abgebildet. Diese Stellung, welche eine größere Festigkeit des Ganzen erzwecken sollte, aber im Gebrauch der Waffe sehr behindern musste, dürfte wahrscheinlich ein bloßes Projekt gewesen sein. — Die Pikeniere erscheinen übrigens bei Mazzioli nebst der Pike auch mit einer im Degengurt steckenden Pistole mit Flintenschloss bewaffnet und mit einer kleinen Patronentasche ausgerüstet. — Für die Musketen schlägt er Patronentaschen mit zwölf blechernen Hülsen und in diesen Papierpatronen mit aufgebundener Kugel vor. Er beklagt, dass früher bloß die Kugel ohne Pfropf in den Lauf geworfen, oft sogar ohne Ansetzen mit dem Ladstock, nur durch Aufstoßen des Kolbens schlecht geladen wurde und empfiehlt das Aufbeißen der Patrone. Die bisher üblichen Bandouliere mit Holzpatronen tadelt er wegen des von ihnen hervorgebrachten Geräusches, ihrer Untauglichkeit und ihrer Feuergefährlichkeit.7
Um 1600 hieß ein breiter kurzer Degen «Plaute», vielleicht von dem Worte Platte abgeleitet?
1598—1700. Man irrt, wenn man die übermäßige Schwere der Harnische einer bestimmten Periode Deutschlands zuschreibt.8 Seit die geschlagenen Harnische die Ring- und Schuppenpanzer verdrängten, bis zu der Zeit, wo die Rüstung auf Bruststück und Helm oder auf erstere allein zusammenschmolz, kamen Übertreibungen in den Scharen teils vereinzelt, teils häufiger vor. Noch am 30. Juli 1598 erstickten auf dem Zug Adolfs von Schwarzenberg gegen Totis einige Knechte in ihren Harnischen, freilich bei außerordentlicher Hitze und Wassermangel. In Surirey de Saint Remy’s «Memoires d’Artillerie» werden Brust- und Rückenkürasse erwähnt, welche nach ihrer Größe für Leute verschiedener Statur dreißig bis fünfunddreißig Pfund Schwere hatten, während die dazu gehörigen Eisenhauben (pots) sechzehn bis achtzehn Pfund wogen.
1 Die Ableitung aus dem Deutschen mag wohl richtig sein, aber die Bezeichnung Brin d’estoc ist in Beziehung auf dessen Gestalt französisch durchaus nicht inkorrekt, denn brin bedeutet einen Halm, gerade aufgeschossenen Stamm und estoc eine spitzige unbiegsame Klinge. Wir wollen aber mit dieser Bemerkung den Verfasser durchaus nicht ins Unrecht setzen.
2 Auch Blechscheibe.
3 Diese besondere Beobachtung habe ich nicht gemacht. Nach der meinen fanden sie sich sowohl auf der einen wie auf der anderen Brustseite, meistenteils aber an der unteren Brusthälfte. Die Schussprobe bestand in dem Schuss einer Bleikugel aus einem Halbhaken auf 100 Schritte Entfernung; dabei durfte die Kugel weder das Bruststück durchlöchern, noch auch einen Riss erzeugen, sondern dieses musste ungeachtet des Eindrucks vollkommen gebrauchsfähig bleiben.
4 Die Franzosen von 1797 waren ihrerseits von ähnlichen Besorgnissen frei.
5 Sie rührten noch vom vorigen Feldzüge 1812 her, taten aber in der Winterkampagne 1813 gute Dienste.
6 Die Tardaeisen finden sich in den Inventarien des Landeszeughauses zu Graz bis 1647. (Die Waffen des Landeszeughauses zu Graz von F. G. v. M. 1880.) Diese leichten Spießeisen leiten ihre Namen von dem arabischen «djerid» (Wurfspieß) ab. Eben daher stammt auch das französische dard, welches eine gleiche Waffe bezeichnet. Die Franzosen scheinen den dard in den Kämpfen mit den Mauren unter den Karolingern übernommen zu haben; wir schließen dies daraus, weil derselbe auch unter der Bezeichnung «algier» auftritt. In der Tat geschieht auch erst im Rolandslied eine Erwähnung der dards (darz). Im Nibelungenlied suchen wir das Wort vergebens, doch spricht von selber der romanische Poet Wilhelm Guiart 1302. Damals und überhaupt vom 12. Jahrhundert schon an wurde der Name auf den gemeinen leichten Fußknechtspieß übertragen und erhielt sich in dieser Bedeutung bis ins 17. Jahrhundert. Also die Steiermärker erhielten das Wort nicht von den Franzosen, sondern von den Arabern durch die Türken auf geradem und nicht auf dem Umweg über Frankreich, was sich schon aus den jahrhundertelangen Kämpfen mit Arabern und Türken erklären lässt.
7 Die Erwähnung dieser für jene Zeit gewiss praktischen und von einem großartigen Erfolg begleitet gewesenen Vorschläge für die Ausrüstung führt uns auf die Bemerkung, dass wir vom Mittelalter her die bedeutendsten Erfindungen auf dem Gebiet des Waffenwesens den Italienern zu verdanken haben; ja man kann sagen, dass alle übrigen Nationen zusammengenommen die Verdienste der Italiener darin nicht überbieten. Freilich treffen wir in den zahllosen militärischen Werken nicht selten auf verfehlte, unausführbare und selbst ganz unsinnige Projekte. Zu einem solchen dürfte wohl jenes in dem Werk des Venetianers Cicogna zählen, welcher die Befestigung in Form einer heraldischen Lilie empfiehlt, weil sie eine schöne Blume sei, gut röche und das Symbol einer Familie sei, für die der profunde Verfasser von jeher eine große Verehrung gehegt habe. Unsinnigeres konnte man selbst im 18. Jahrhundert, in welchem das Foliowerk erschienen ist, nicht schreiben.
8 Nach meinen Beobachtungen erhalten die deutschen, niederländischen und teils auch die französischen Helme und Brustharnische erst am Ende des 16. Jahrhunderts eine zuweilen ganz erschreckend übertriebene Schwere. Die überwiegend größte Anzahl derselben sind aber sogenannte Trancheeharnische, besonders jene der Niederländer. Die Franzosen führten ganz ansehnlich schwere Trancheeharnische noch unter Louis Philippe um 1840. In der kaiserlichen Waffensammlung zu Wien wird ein ganzer Harnisch von außerordentlichem Gewicht bewahrt. Eine dazu gehörige Sturmhaube wiegt allein 12 Kilogramm. Er ist von niederländischer Herkunft.
Quelle: Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde: Organ des Vereins für Historische Waffenkunde. Band 1, Heft 11.
