

Die Partisane ist eine klassische Stangenwaffe der Renaissance und des Barock, die sich durch ihre charakteristische,
elegante Form und ihre vielseitige Verwendbarkeit auszeichnet. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert war sie sowohl auf dem Schlachtfeld als auch als Zeremonialwaffe weit verbreitet. Im Gegensatz
zur brutal wirkenden Hellebarde steht die Partisane für eine Weiterentwicklung taktischer Infanteriewaffen, die Präzision und Repräsentation miteinander vereinte.
Was ist eine Partisane?
Die Partisane (auch „Partisanen-Spieß“) ist eine Stichwaffe mit seitlichen Klingen, montiert auf einem langen Holzschaft (1,8 bis 2,5 Meter). Sie kombiniert Elemente des Speers mit dekorativen
oder funktionellen Seitenschneiden.
Typische Merkmale sind: Lange Mittelspitze (zum Stechen, oft dreikantig); Zwei kürzere Seitenklingen (symmetrisch oder leicht gebogen); Teilweise reich verziert (v. a. bei zeremoniellen
Exemplaren); Starker, meist runder Holzschaft; Metallmanschette zur Befestigung der Klinge. Die Partisane war in erster Linie eine Stoßwaffe, konnte aber mit den Seitenflügeln auch blocken,
schneiden oder gegnerische Waffen ablenken.
Entstehung und historische Einordnung
Die Partisane entstand im späten Mittelalter, erreichte ihre klassische Form jedoch im 16. Jahrhundert. Sie ersetzte in vielen Armeen den traditionellen Spieß oder Langspeer, da sie taktisch
flexibler war. Sie wurde besonders in italienischen und französischen Heeren beliebt.
Die Partisane war eine typische Waffe der leichten Infanterie, Gardisten und Elitesoldaten und der Zeremonialwachen. Im Gegensatz zu schweren Hellebarden war sie leichter und besser geeignet für
präzises Stechen, z. B. gegen Reiter oder in engen Formationen.
Taktische Verwendung
Obwohl sie weniger „brutal“ wirkte als eine Hellebarde, war die Partisane eine effektive und tödliche Waffe. Ihre Stärke lag in der Vielseitigkeit und Reichweite.
Haupttaktiken waren der Stoß gegen Reiter oder Fußsoldaten: Die Mittelspitze konnte leicht durch Rüstungslücken dringen. Blockieren und Parieren: Die Seitenflügel fingen gegnerische Hiebe ab oder
hakten Waffen ein. Ordnung halten: In Formationen diente die Partisane auch der Disziplinierung und Kommandogabe. In der Schutztruppe von Offizieren (sog. Trabanten oder Garden) trugen viele
Partisanen – einerseits zur Abwehr, andererseits zur Repräsentation.
Zeremonielle und repräsentative Funktion
Ab dem späten 16. Jahrhundert entwickelte sich die Partisane zunehmend zu einer Repräsentationswaffe bei Ehrenwachen, Staatsakten und Paraden; In den Händen von Leibwachen und Gardisten. Sie
waren oft kunstvoll verziert mit Gravuren, Wappen, Inschriften und aufwendigen Blattornamenten. Auch heute noch sind Partisanen bei traditionellen Garden zu sehen, z. B.: Schweizer Garde im Vatikan (neben
Hellebarden) Historische Stadtwachen in Italien und Süddeutschland.
Unterschiede zur Hellebarde
Obwohl beide zu den Stangenwaffen zählen, unterscheiden sich Partisane und Hellebarde deutlich in Konstruktion und Einsatzzweck:
Merkmal Partisane
Hellebarde
Hauptfunktion Stichwaffe
Hieb-, Stich- und Reißwaffe
Seitenklingen Kurz, zur Stabilisierung oder Parierhilfe Beil und Haken
Gewicht Leichter
Schwerer
Zeremonialnutzung Häufig
Auch, aber meist in einfacher Form
Taktischer Einsatz In disziplinierten Formationen Besonders gegen Reiter geeignet
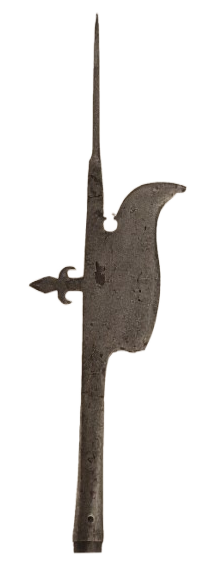
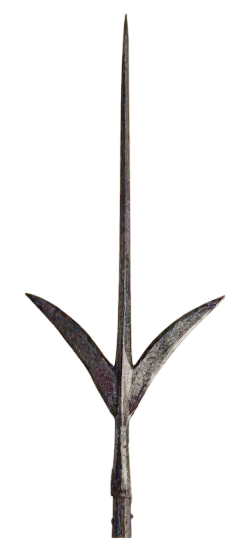
Das Spetum (auch Ranseur, Runke, Runka, Friauler Spieß, corseca, corsesque, chauve souris) ist eine elegante, aber gefährliche Stangenwaffe, die vor allem in der Renaissance und im
frühen Barock verwendet wurde. Charakteristisch ist seine markante Dreizack-Form, die ihn sowohl optisch als auch funktional von anderen Stangenwaffen wie der Partisane oder der Hellebarde
unterscheidet. Ursprünglich für den Kriegseinsatz konzipiert, wurde der Ranseur später auch zur Zeremonialwaffe und diente in Wachen, Paraden und als Rangzeichen für Offiziere.
1. Was ist das Spetum?
Das Spetum ist eine Stoßwaffe mit einer langen Spitze und zwei kürzeren, seitlich nach außen oder leicht aufwärts gebogenen Klingen – ähnlich einem verfeinerten Dreizack. Typische Merkmale sind:
Lange zentrale Spitze (meist spitz und schmal), zwei kürzere Seitenzinken, oft wie Haken oder Flügel; langer Holzschaft, etwa 2 bis 2,5 Meter; teilweise mit Metallmanschette oder dekorativem
Fußstück. Meist leichter als eine Hellebarde, aber schwerer als ein Speer. Der Aufbau ähnelt der Partisane, doch die Seitenzinken des Ranseurs sind stärker ausgeprägt, teils auch gezahnt oder
eingekerbt.
2. Herkunft und Entwicklung
Das Spetum entwickelte sich aus dem mittelalterlichen Spieß und ist eng verwandt mit der Partisane, wurde aber wahrscheinlich später eingeführt – etwa ab dem 15. Jahrhundert. Er kam besonders in
Regionen Westeuropas vor, darunter: Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland.
3. Militärische Nutzung und Taktiken
Das Einsatzgebiet ist die Infanteriewaffe zur Verteidigung gegen Reiter; Bewaffnung von Wachen, Palasttruppen, Leibgarden; Kommandowaffe für Offiziere in der Feldformation
Die mittlere Klinge diente zum präzisen Zustoßen. Die Seitenzinken konnten gegnerische Klingen blocken oder aushebeln. Die Hakenform ermöglichte es, Schilde oder Waffen aus der Hand zu reißen.
Ideal zur Abwehr von Angriffen zu Pferd – ähnlich wie bei Partisane und Piken. Das Spetum wurde nicht für Hiebtechniken eingesetzt – im Gegensatz zur Hellebarde. Seine Stärke lag in der
Kontrolle: Blockieren, Halten, Stoßen.
4. Zeremonielle und repräsentative Funktion
Wie viele andere Stangenwaffen verlor auch das Spetum im 17. Jahrhundert seine militärische Bedeutung – wurde aber als Zeremonialwaffe weitergeführt: In Königlichen Garden, Stadtwachen; Bei
Paraden, Prozessionen und feierlichen Empfängen; Als Standeszeichen höherer Offiziere.
5. Vergleich zu ähnlichen Waffen
Waffe Hauptfunktion Seitenklingen
Hiebfunktion Typischer Einsatzzeitraum
Spetum Stich & Entwaffnung Haken- oder Flügelzinken Nein
15.–17. Jh.
Partisane Stich & Parieren Flügelklingen
Leicht 15.–17. Jh.
Hellebarde Hieb, Stich, Reißen Axtblatt + Haken Ja
14.–16. Jh.
Spieß/Pike Reiner Stoß Keine
Nein 13.–17. Jh.
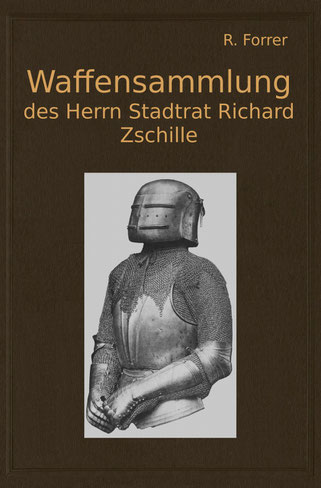
Weiterführende Literatur:
Waffensammlung des Herrn Stadtrat Richard Zschille in Großenhain (Sachsen)
Band 1 und 2
Mit 232 Tafeln
von Robert Forrer (Autor)
Sprache: Deutsch
ISBN: 9783748518488
Format: Taschenbuch
Seiten: 348 (TB-Format)
Erscheinungsdatum: 08.03.2019
Ladenpreis: 19,95 Euro
Überarbeitetes Reprint von 1896.
Einblick ins Buch hier.

Meister der Waffenschmiedekunst vom 14. bis ins 18. Jahrhundert
Ein Beitrag zur Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks
von Wendelin Boeheim
Ladenpreis: 24,95 EUR
292 Seiten
Format: Taschenbuch
Erscheinungsdatum: 30.01.2025
ISBN: 978-3-819022-34-0
Sprache: Deutsch
Einblick ins Buch hier
